Unsere Mediathek
Die Stabkirche – katholisches Phänomen des Nordens
Erschienen in:
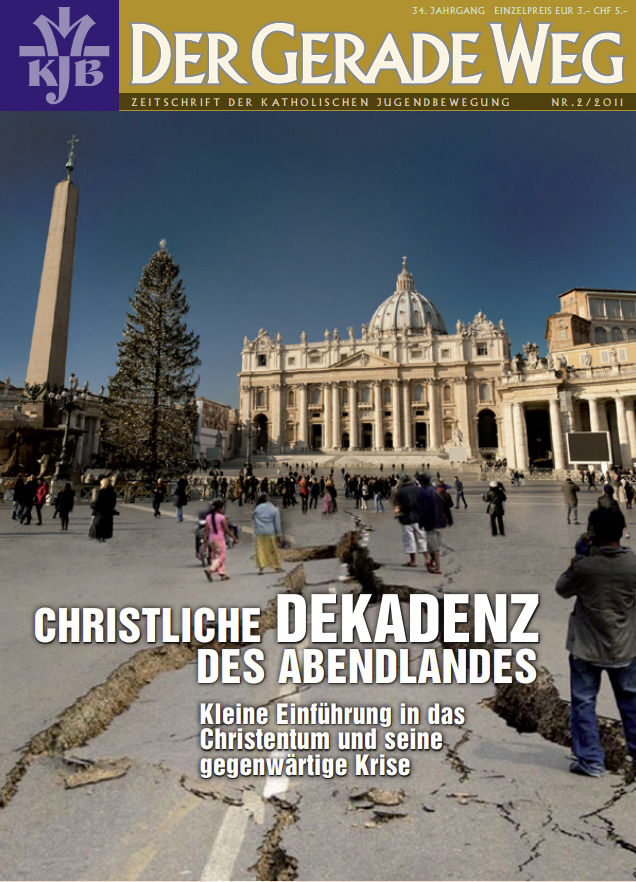
Der Typus der Stabkirche entstand am Anfang des 11. Jahrhunderts in Süd- und Mittelnorwegen, als in Skandinavien das Christentum nach einer zweihundertjährigen Missions- und Übergangszeit endgültig Fuß gefasst hatte. Die Impulse der Mission kamen aus England und Deutschland, wo vor allem der hl. Ansgar (796– 865), der Erzbischof von Hamburg und Bremen, Anstöße gab.
Vorangetrieben wurde die Mission durch die norwegischen Könige Haakon I. (920–961), Olav I. (963–1000) und durch den hl. Olav II. (995–1030, den Nationalheiligen von Norwegen), die sich in England ausbilden und taufen ließen.
Die Bauweise der Stabkirchen nahm eine eigenständige Entwicklung mit deutlicher Anlehnung an den Schiffbau der Wikinger. Die Kenntnisse aus dem Schiffbau halfen, sehr hohe Dachstühle zu entwickeln, von denen aus Licht in die Kirche kam, weil im unteren Bereich meist nur sehr kleine oder gar keine Fenster vorhanden waren. Zum Bau der Stabkirchen wurde Holz verwendet. Holz gab es in Skandinavien in ausreichender Menge und die Norweger hatten hervorragende Kenntnisse dieses Materials. Die Kirchen wurden ganz ohne Metallnägel oder Metallbolzen gebaut, alles entstand aus massivem Holz, meistens Kiefernholz. Man geht heute nach neueren Berechnungen davon aus, dass eine größere Stabkirche aus ca. 2000 Einzelteilen besteht, die unzähligen Dachschindeln nicht mitgerechnet.
Die Stabkirchen wurden im Baukastensystem – wie bereits erwähnt ohne Metallschrauben oder Metallnägel – zusammengesetzt. Auf einem Steinfundament liegt ein Rahmen aus schweren Holzbalken. Solide Eckpfosten und Pfeiler (Stäbe, Masten) wurden in geschickter Klammertechnik mit dem Rahmen verzahnt, senkrechte Planken (Bretter) im Nut- und Feder- Prinzip füllen die Zwischenräume aus. Bei einem Blick in die Dachkonstruktion der Kirche scheint die Schiffsbautechnik weiterzuleben. Andreaskreuze stützen das Gebälk ab und geben den Wänden Stabilität. Die Konstruktion ruht im Wesentlichen auf den Stäben (Masten), die im Mittelschiff in die Höhe ragen (1, 4, 8, 12 oder 20 Stäbe). Durch das hoch aufgetürmte Dach erinnern die Stabkirchen ein bisschen an asiatische Pagoden, wie man sie in Thailand sehr schön sehen kann. Das treppenförmige Dach zieht sich tief über den Svalgang (= überdachter Umlaufgang um die Kirche) herunter, der vor allem die Witterung fernhalten sollte und in dem die Männer die Waffen ablegten bevor sie die Kirche betraten. In der Zeit, als die Stabkirchen gebaut wurden, war es noch nicht selbstverständlich, dass jeder Bürger lesen und schreiben konnte. Gab es etwas Schriftliches zu erledigen, ging man nach der Sonntagsmesse zum Priester, der für die Bürger da war und sie beriet. Solche Schriftsachen gehörten aber nicht in die Kirche, sondern wurden im Svalgang erledigt.
Die Stabkirche gleicht in Form und Einrichtung den übrigen katholischen Kirchen des Mittelalters. Sie besteht aus Schiff und Chor. Im Eingangsbereich hinten steht meist ein Taufbecken aus Holz oder Stein. Während der hl. Messe standen die Gläubigen im Mittelschiff, lediglich an den Außenwänden gab es für die Alten und Kranken eine Sitzgelegenheit. Die Stabkirchen sind wie alle katholischen Kirchen damals nach Osten, zur aufgehenden Sonne ausgerichtet: Der Eingang liegt im Westen, der Altar weist nach Osten.
Im Inneren, besonders in der Apsis kann man teilweise bis heute sehr schöne Malereien sehen. Rosenmalereien verzieren die Wände und oftmals wurden als Schmuckelement Bildteppiche im Bereich des Chores aufgehängt.
In der Stabkirche von Torpo (12. Jh.) kann man Christus sehen, umgeben von den Symbolen der 4 Evangelisten und den 12 Aposteln sowie im unteren Bereich von Heiligen.
Nicht zu übersehen ist, dass die Romanik auf die Stabkirchen Einfluss ausübte. Die Apsiden und Säulenkapitelle (in Würfelform) lassen dies deutlich erkennen.
Obwohl die Stabkirchen fast 200 Jahre nach dem Beginn der Christianisierung Norwegens errichtet wurden und die Missionare keinen Synkretismus duldeten, finden sich an den Bauwerken viele heidnische Elemente.
Die Skandinavier waren nicht einfach zu missionieren, noch lange nach deren Missionierung waren die alten Sagen und heidnischen Vorstellungen im nun christlichen Volk lebendig. Der Drache galt in der nordisch-heidnischen Religion als Dämon, der nur durch sein eigenes Bildnis gebändigt werden konnte. So gibt es auf den Dächern der Stabkirchen neben den Kreuzen auch Drachenköpfe die das „Dämonische“ von dem Ort und der Kirche fernhalten sollten. Die stilisierten Drachenköpfe haben also dieselbe Funktion wie die Fratzen der Wasserspeier an vielen europäischen Steinkirchen und Kathedralen. Ebenso verstanden die Menschen die hohe Türschwelle („Geisterschwelle“) der Kirche, über die man steigen muss: So wollte man die Naturgeister vom Heiligen Ort fernhalten.
In den Jahren zwischen 1150 und 1350 wurden in ganz Norwegen ca. 2000 Stabkirchen errichtet. Angesichts der dünnen Besiedlung Norwegens ist das eine enorme Leistung. Dies bedeutete, dass pro Jahr ca. 10 Kirchen gebaut wurden. Heute benötigt man für die Reproduktion einer einzelnen Stabkirche oft einige Jahre. Nach der Reformation im Jahre 1537 wurden in Norwegen keine Stabkirchen mehr gebaut. Viele Kirchen wurden in dieser Zeit umgebaut oder ganz abgerissen und durch Steinkirchen ersetzt. So kann man sagen, dass die Stabkirchen ein katholisches Phänomen des Nordens sind. Die berühmteste und wohl auch schönste Stabkirche ist die Stabkirche von Borgund (1150). Sehr eindrucksvoll sind auch die Kirchen in Hopperstad und Heddal.
Viele dieser Kirchen sind im Lauf der Jahrhunderte verwittert oder wurden durch Kriege zerstört. Während Pestepidemien in Skandinavien im 16. und 17. Jh. wurden viele Kirchen verbrannt. 1850 gab es noch etwa 60 Stabkirchen in Norwegen, heute sind es noch 28, die zum Weltkulturerbe zählen. Die Missionierung Skandinaviens ging hauptsächlich von Norwegen und Schweden aus; auch in Schweden gab es Stabkirchen. Leider ist in Schweden kein Original mehr erhalten geblieben. Inzwischen ist man sich in Skandinavien der Einzigartigkeit der Stabkirchen bewusst, sodass man sogar in den letzten Jahren wieder an einigen Orten Stabkirchen errichtet und neu gebaut hat. Um die Stabkirchen gegen Pilzbefall, Fäule und Nässe zu schützen, werden sie noch heute regelmäßig mit Holzteer gestrichen.
So gibt es in Norwegen 28, in Schweden 5 neue, nachgebaute Stabkirchen, in Island in Vestmannaeyjar eine aus dem Jahr 2000. In Deutschland kann man in Hahnenklee im Harz eine nachgebaute Stabkirche sehen sowie im norwegischen Viertel des Europa-Parks in Rust bei Freiburg.