Unsere Mediathek
Meine Berufung ist die Liebe – Die Botschaft der hl. Theresia von Lisieux
Erschienen in:
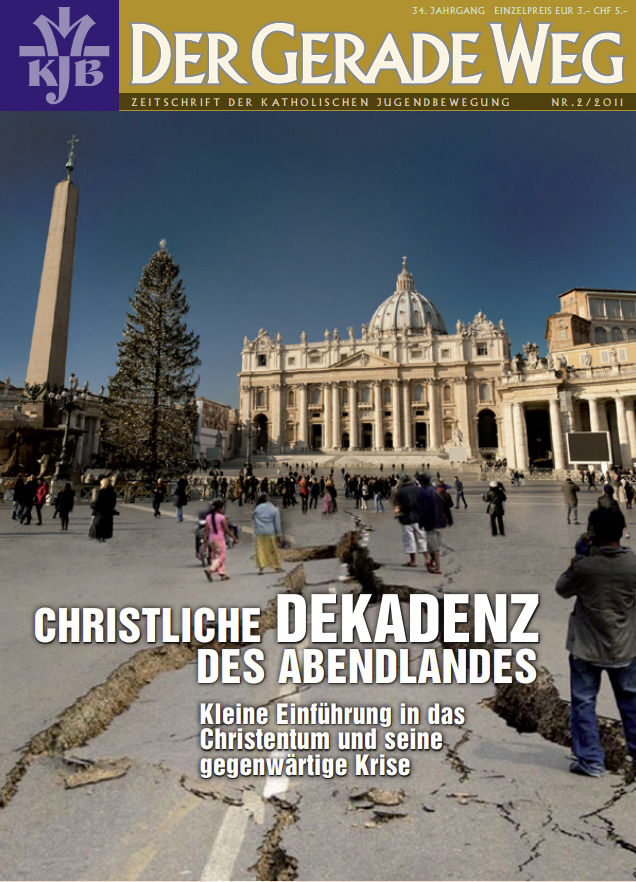
Schon viel ist über die kleine heilige Theresia geschrieben worden, auch im DGW. Warum also wieder einen Artikel über sie schreiben? Die Antwort ist einfach: Alles dreht sich bei ihr (wie auch bei allen anderen Heiligen) um die eine, zentrale Frage unseres Lebens, nämlich wie wir Gott mehr lieben können. „Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen in sich schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umspannt … mit einem Wort, dass sie ewig ist! (…) Endlich habe ich meine Berufung gefunden, meine Berufung ist die Liebe!“1 Ja, die hl. Theresia hat die Liebe zweifellos gefunden. Wir möchten uns daher in diesem Artikel auf die Suche machen, wie Theresia sie gefunden hat, um u. a. auch einige Grundsätze auf unser eigenes geistliches Leben anwenden zu können.
Ausgehend von oben genanntem Zitat bietet es sich an, Theresias Innenleben anhand einer Kirche darzustellen. Als Karmelitin war sie eine Tochter der Kirche und ihr Lebensinhalt, „Lieben, geliebt werden und auf die Erde zurückkehren, um zu bewirken, dass die Liebe geliebt wird!“2, stimmt vollkommen mit dem sehnlichen Wunsch der hl. Kirche für ihren göttlichen Bräutigam überein. Auch Theresia wirkte missionarisch und wollte bis an die Enden der Erde gehen, um das Evangelium zu verkünden. Auch sie war vom Heiligen Geist geführt, der mitten in ihrer Seele thronte und dort das Feuer der Liebe lebendig erhielt.
Das Fundament: Die Betrachtung
Doch beginnen wir beim Fundament, mit dem alles steht und fällt. Was war die Basis der Heiligkeit Theresias? Es war die Betrachtung. Die Betrachtung – das ist etwas für Nonnen und Mönche oder für sehr eifrige KJBler. Oder doch nicht? Der Grundsatz, „Ich kann nichts lieben, wenn ich es nicht kenne“, scheint ja nicht verkehrt zu sein. Aber welche Konsequenzen ziehe ich daraus?
Wahre Betrachtung
Schauen wir uns zunächst einmal an, was die Betrachtung genau ist. Sie ist ihrem Wesen nach ganz einfach, denn Betrachtung bedeutet nichts anderes, als bei Gott zu weilen und Ihn anzuschauen.
Dabei machte Theresia eine prägende Entdeckung: Sie schaute einen Gott der Liebe und sie entdeckte Seine abgrundtiefe Barmherzigkeit, während man früher eher Seine Gerechtigkeit betonte. Sie sah, wie sehr Gott danach verlangt, die Menschen mit Liebe zu überhäufen und dass wir Ihm die größte Freude bereiten, wenn wir uns bei Ihm aufhalten. Auch bei uns Menschen ist das so: Je näher sich zwei einander Liebende sind, umso glücklicher sind beide. Nicht, dass Gott uns zu Seiner Seligkeit bräuchte, doch sein ganzes Wesen trachtet danach, dass wir unsere Freiheit benutzen, um lebenslang bei Ihm zu sein.
Diese Erkenntnis bestimmte das Leben Theresias entscheidend: Sie trachtete in allen Handlungen danach, Gott Freude zu bereiten. Dies ging so weit, dass sie sogar ihre Leiden vor Ihm verbergen wollte. Es war Winter: „Der liebe Gott liebt mich. Es gefällt Ihm nicht, wenn ich friere und so sehr leide. Ich tue es heimlich, damit der liebe Gott mich nicht sieht, damit Er keinen Kummer hat.“3
Durch die Menschheit Jesu zu Seiner Gottheit gelangen
Schauen wir uns aber noch genauer an, wie Theresia Gott gefunden hat. Bei ihrem täglichen Anschauen Gottes suchte sie v. a. das heiligste Antlitz, um dahinter die Person und das Wesen Christi zu erfassen. Dieses fand sie in den Weissagungen von Jesaja über das zerschundene Angesicht Gottes und im Evangelium. Überhaupt war die Hl. Schrift die Lieblingsquelle Theresias: „Manchmal, wenn ich gewisse geistliche Abhandlungen lese, in denen die Vollkommenheit durch tausenderlei Erschwerungen hindurch und von einer Menge Illusionen umgeben beschrieben wird, ermüdet mein armer kleiner Geist gar schnell. Ich schließe das gelehrte Buch, das mir Kopfschmerzen bereitet und das Herz austrocknet, und greife zur Heiligen Schrift. Dann erscheint mir alles voll Licht. Ein einziges Wort erschließt meiner Seele unendliche Horizonte, die Vollkommenheit erscheint mir leicht, ich sehe, dass es genügt, sein Nichts zu erkennen und sich wie ein Kind Gott in die Arme zu werfen.“4 Wie ihre große Schwester, Teresa von Avila, betrachtete Theresia zunächst die uns nähere menschliche Natur Christi, um dadurch einen Zugang zur Gottheit Christi zu finden. Sie wollte die Empfindungen des Herzens Jesu, die Vorlieben und die Handlungsweise Jesu entdecken, um Ihn schlussendlich nachzuahmen. Auch wir können uns im Alltag fragen: Wie würde Christus oder Maria an meiner Stelle handeln? Wüssten wir es?
Bei Trockenheit nicht aufgeben
Die kontemplativen Erfahrungen Theresias wurden zunächst von Frömmigkeit und angenehmen Empfindungen begleitet. Doch schon bald wurde sie in äußerste Trockenheit versetzt und sie fand den Zugang zu Gott nur noch im Glauben. Sie empfand dabei weder Gefallen noch Überdruss: „Jesus führt mich in einem unterirdischen Gang, wo es weder kalt noch warm ist.“5 Am stärksten spürte sie die Trockenheit während der hl. Kommunion, wo sie häufig nicht einmal einen Gedanken fassen konnte: „Ich rufe die Heilige Jungfrau und die Heiligen herbei, damit sie zu Jesus etwas sagen, denn ich selbst weiß Ihm nichts zu sagen.“6 Man könnte meinen, ein solches Danksagungsgebet käme von einer schlechten Ordensfrau. Doch es zeigt uns, dass Theresia eingesehen hatte, dass sie nicht einmal Herr über ihre Gefühle und Gedanken war, sondern sich ganz Gott übergab, ohne sich dabei aufzuregen oder zu betrüben. Sie verstand, dass der Mensch aus sich heraus nichts kann und Gott ließ es sie während ihres ganzen Ordenslebens spüren: „Meine innere Beziehung zu Gott? Nichts. Ausgedörrtheit. Schlummer. Da mein Geliebter schlummern will, werde ich Ihn nicht stören. Ich bin überglücklich, zu sehen, dass Er mich nicht wie eine Fremde behandelt und sich keine Förmlichkeiten mit mir aufzuerlegen braucht.“7
Die Einfachheit
Schließlich ist es die Einfachheit, die uns zurreinen Kontemplation gelangen lässt. Betrachtung meint einfaches Schauen ohne verzierende Gedanken oder fromme Regungen. Diese lenken uns zuweilen sogar ab, denn sie nähren vielleicht unbewusst den stolzen Gedanken, aus uns selbst gut beten zu können. Doch nur durch den einfachen Blick gelangt die Seele ins Innere Gottes! Wer wünschte sich nicht, eine tiefe Beziehung zu Gott zu haben, ja, bis in Sein Inneres zu gelangen? Hier ist die Lösung: Durch das einfache Anschauen wird das Göttliche in unsere Seele gegossen, bis sie schließlich umgeformt ist und wahrhaft Göttliches, d. h. Heiliges vollbringt. Und dieses Göttliche muss nach außen hin nicht sichtbar sein. Eine Karmelitin von Lisieux bemerkte: „Diese Kleine! Unsere Mutter wird sehr in Verlegenheit sein, um den Rundbrief nach ihrem Tod zu verfassen, denn sie hat nichts getan, was die Mühe lohnen würde, davon zu erzählen.“ 8
- Säule: Die Armut
Der Begriff des „kleinen Weges“ der hl. Theresia ist weithin bekannt. Wenn man ihn auf das Bild der Kirche projiziert, könnte man ihn in drei Säulen darstellen. Die erste Säule, welche Theresia in ihrem Leben umgesetzt hatte, war die Armut. Damit ist zunächst sicherlich eine Liebe zur materiellen Armut gemeint, die sie in ihrer Kindheit durch die Fürsorge für die Hungrigen und Obdachlosen ihrer Umgebung hegte. Die Armut des „kleinen Weges“ zielt jedoch vor allem auf die geistliche Armut hin. Was ist damit gemeint?
Scheinbar von Gott verlassen, fand Theresia im Karmel das „Nichts“ des hl. Johannes von Gott, denn – wie schon erwähnt – empfand sie bei geistlichen Übungen weder Freude noch Kälte. Sie empfand nichts. Und dieses Unvermögen ließ sie erkennen, wie schwach und unbedeutend der Mensch im Vergleich zu Gott ist. Hier jedoch machte Theresia einen äußerst wichtigen Schritt: Anstatt sich darüber zu betrüben, dass man immer wieder in die gleichen Sünden fällt und dass man rein gar nichts aus sich heraus vermag, wurde die Erkenntnis dieser Armut zum rettenden Anker für Theresia. Dank des Evangeliums sah sie nämlich, wie Christus auf Sünder und Schwache reagiert: Nicht zu den Gerechten ist Jesus gekommen, sondern zu den Sündern, die des Arztes bedürfen (vgl. Mk 2,17). Gerade die Armseligkeit und der stinkende Unrat ziehen Christus an! Jesus möchte selig machen, was verloren war (vgl. Mt 18,11). Christus weilte bei den Schwachen, die ihr Wesen erkannt haben (vgl. das Gebet des Zöllners in Lk 18,9 ff.), und nicht bei den stolzen Pharisäern, die sich mit ihren Verdiensten brüsteten.
Von nun an bemühte sich Theresia, Jesus keine Verdienste mehr zu präsentieren, sondern Ihm ihre leeren Hände zu zeigen, damit Er sie mit Seinem Erbarmen lieben könne.
Daher rührt auch Theresias ungewöhnlicher Ausspruch: „Die Erkenntnisse über meine Armut tun mir mehr Gutes als die Erkenntnisse über Gott.“9
- Säule: Die Treue
Die Treue der hl. Theresia war eine Treue im Kleinen. Doch worauf bezieht sich die Treue überhaupt? Als Ordensfrau hatte Theresia gewiss andere Verpflichtungen und ihre Treue bestand darin, die Regeln und Anordnungen der Oberen zu befolgen. Was können wir für uns daraus für Konsequenzen ziehen?
Auch für Theresia galt der gleiche Grundsatz: Mein Leben soll eine treue Antwort auf die Liebe Gottes sowie das „Amen“ des Taufgelübdes sein. Und zwar vollzieht sich diese Treue im Hier und Jetzt mit den mir gegebenen Fähigkeiten und in dem Lebenszustand, in dem ich mich zurzeit befinde – einfacher ausgedrückt: Die Treue liegt in der Ausübung der Standespflichten. Als Kind bin ich z. B. verpflichtet, meine Eltern zu ehren, sie nach Kräften zu unterstützen und den Geschwistern ein gutes Vorbild zu sein. Als Schüler bin ich verpflichtet, gut im Unterricht mitzumachen und zu lernen. Als höchste Standespflicht jedoch gilt die Anbetung Gottes, die für jeden Christen eine Ehre sein soll. Denken wir daran, wenn wir unseren freien Sonntag genießen, dass es zugleich der Tag des Herrn ist, an dem die Seele sich stärker mit ihrem letzten Ziel befassen sollte. Sind wir uns bewusst, dass es eigentlich unsere höhere Standespflicht ist, die eigene Heiligung im Gebet zu üben, anstatt sich zu viele Sorgen um die Schule oder die Prüfungen zu machen? Wie oft bleibt das geistliche Leben auf der Strecke, weil man „keine Zeit“ hat. Dabei ist die Lösung einfach: Wer keine Zeit hat, hat nur das Problem, dass er sich keine Zeit nimmt.
Bei Theresia spielte jedoch nicht nur die Ausübung der Standespflicht eine Rolle, sondern vielmehr die Qualität derselben. Ihre Erfahrungen mit Bußwerkzeugen, die zur damaligen asketischen Lebensweise gehörten, führten sie zu einer anderen Überzeugung: Nicht Eisenkreuze aus Stacheln, die sie erkranken ließen, müssen in jedem Fall Gottes Wille sein, sondern die heutige Askese bestehe vielmehr in der Ausübung der Standespflichten.
Wie sie dies umsetzte, sieht man gut an folgender Begebenheit: Im Karmel gab es eine recht schrullige Schwester, die Hilfe für ihre Arbeit brauchte, aber entsetzlich pingelig war: So und nicht anders musste man sich setzen, die Nadel halten etc. Alle liefen ihr davon, so sehr reizte sie ihre Mitschwestern. Als Theresia eines Tages sah, wie sie ohne Hilfe war, bat sie die Priorin, sie zu ihr zu schicken. Sie ging also, setzte sich liebenswürdig hin und verrichtete alles nach Vorschrift jener Schwester. Jedes Mal, wenn Theresia jedoch einen Ärger gegen sie verspürte, lächelte sie ihr wohlwollend zu. Dies dauerte einige Monate!
Nach dem Tod Theresias sagte diese Schwester über sie aus: „O ja, Schwester Therese war so freundlich, so gut, so liebenswürdig! Was mich betrifft, empfinde ich ihr gegenüber keine Reue; denn die ganze Zeit, die sie bei mir war, habe ich sie sehr glücklich gemacht!“10
- Säule: Das Vertrauen
Als Theresia drei Jahre alt war, fragte sie ihre Mutter eines Abends: „Mama, komme ich wohl in den Himmel?“ Die Mutter bejahte unter der Bedingung, dass sie aber brav und artig sein müsse. Darauf meinte Theresia bestürzt: „Und wenn ich nicht lieb und artig bin, komme ich dann in die Hölle? Aber ich weiß, was ich tun würde. Ich würde mit dir fortfliegen und du kommst doch ganz gewiss in den Himmel. Du müsstest mich einfach auf den Arm nehmen und festhalten. Wie sollte da der liebe Gott mich von dir wegnehmen?“
Die kindliche Einfalt, das grenzenlose Vertrauen in die Güte und Geborgenheit der Eltern hatte Theresia auch in späteren Jahren nicht verloren. Das Vertrauen, das sie als kleines Kind in die Eltern setzte, brachte sie später auch Gott entgegen. Sie wusste, dass Er sie nicht fallen lassen, sondern dass Er für sie sorgen würde. Sie regte sich nicht auf wegen Unannehmlichkeiten, sondern war glücklich, dass Gott ihr diese Kreuze schickte – so groß war ihr Vertrauen in die Vorsehung.
Aus dem Vertrauen wächst aber auch eine gewisse Kühnheit. Theresia sorgte sich nicht darum, wie sie Gott alles vergelten könne, sondern sie nahm dankbar alles an, was sie erhielt. Unser Kindschaftsverhältnis zu Gott ist zwar in hohem Maße unverdient, aber Gott will, dass wir uns als Seine Kinder betrachten und uns dementsprechend benehmen. Zögern wir nicht, Jesus als unseren besten Freund anzunehmen.
„‘So innig, wie ein Vater für seine Kinder fühlt, so erbarmt sich unser der Herr‘ (Ps 102,14) … Das ist es, was ich von der ‚Gerechtigkeit Gottes’ denke. Mein Weg heißt Vertrauen und Liebe. Ich kann die Menschen nicht begreifen, die sich vor einem so guten, liebreichen Freunde fürchten.“11
Freude und inneres Licht
So ist also die krönende Tugend des Vertrauens die letzte Säule des geistlichen Weges der hl. Theresia. Als Frucht dieses Weges lodert in der Mitte der Tröstergeist, der die Kirche lenkt und ihr die Freude der Frohen Botschaft ins Herz senkte.
Ja, die Arbeit im Weinberg des Herrn macht fröhlich und die Verpflichtung eines Christen erfüllt uns mit Stolz. Wenn dies im Alltag nicht einfach umzusetzen ist, erinnern wir uns an das innere Licht, das durch Betrachtung, Armut, Treue und Vertrauen genährt werden muss. Gott wird uns nicht fallen lassen, wenn wir uns um Ihn bemühen. Im Gegenteil! Wer sich vergisst, wird reichlich beschenkt, nämlich mit Gott selbst. Schließen wir mit den Worten Theresias, in denen sie sich an ihre Weihnachtsgnade von 1886 erinnert:
„Ja, ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen, das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um anderen Freude zu bereiten, und von da an war ich glücklich!“12
Quellen, Zitate und Inhalt:
Grialou, Maria-Eugen: Meine Berufung ist die Liebe. Trier (Paulinus) 52008.
Karrer, O. (Hrsg.): Thérèse von Lisieux. Geschichte einer Seele. München (Ars Sacra) 1952.
Anmerkungen:
1 Theresia vom Kinde Jesu: Selbstbiographische Schriften, S. 200 f.
2 vgl. M.-E. Grialou: Meine Berufung ist die Liebe, S. 118.
3 Céline Martin: Meine Schwester Thérèse, S. 70.
4 Lettres 1897, an die Missionare (21948): S. 393.
5 ThérèseMartin: Briefe, 146 an Schwester Agnes von Jesus.
6 Theresia vom Kinde Jesu: Selbstbiographische Schriften, S. 176.
7 Ste. Thérèse de l’Enfant Jésus. Lisieux, Office Central 1924 : Poésies, S. 429.
8 vgl. Prozesse der Selig- und Heiligsprechung der hl. Theresia v. K. J. und vom Hl. Antlitz I Bischöflicher Informationsprozess 1993; S. 289.
9 Thérèse Martin: Ich gehe ins Leben ein. Letzte Gespräche der Heiligen von Lisieux, S. 163.
10 Maria-Eugen Grialou: Meine Berufung ist die Liebe, S. 63.
11 Lettres 1897, an die Missionare (21948): S. 392 f.
12 Theresia vom Kinde Jesu: Selbstbiographische Schriften, S. 96 f.